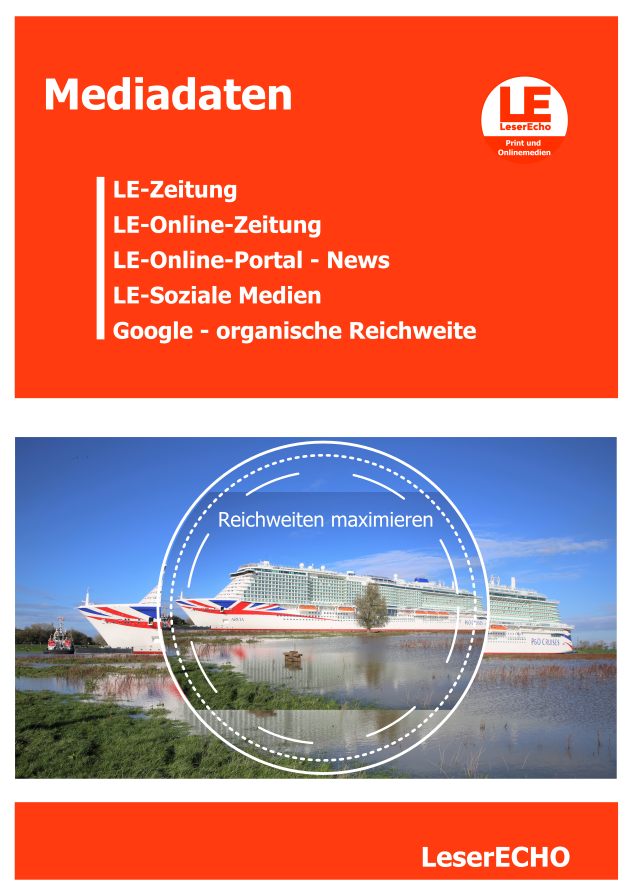News
Eigenanbau und Modellversuch: Wie gründe ich einen “Cannabis Social Club”?

Eigenanbau und Modellversuch — Bundesregierung einigt sich auf Eckpunkte zu Cannabis
Erwachsene sollen künftig Cannabis in bestimmten Mengen privat oder in nicht-gewinnorientierten Vereinigungen anbauen dürfen sowie im Rahmen eines regionalen Modellvorhabens in lizenzierten Fachgeschäften erhalten können. Darauf hat sich die Bundesregierung nach Gesprächen mit der EU-Kommission über das Eckpunktepapier vom 26. Oktober 2022 geeinigt. Ziel bleibt weiterhin, die Qualität zu kontrollieren, die Weitergabe verunreinigter Substanzen zu verhindern, den Jugendschutz sowie den Gesundheitsschutz für Konsumentinnen und Konsumenten bestmöglich zu gewährleisten sowie den Schwarzmarkt einzudämmen.
In einem ersten Schritt sollen der Anbau in nicht-gewinnorientierten Vereinigungen und der private Eigenanbau bundesweit ermöglicht werden. Die Abgabe in Fachgeschäften wird in einem zweiten Schritt als wissenschaftlich konzipiertes, regional begrenztes und befristetes Modellvorhaben umgesetzt. In dem Modellvorhaben können die Auswirkungen einer kommerziellen Lieferkette auf den Gesundheits- und Jugendschutz sowie den Schwarzmarkt wissenschaftlich genauer untersucht werden.
“Cannabis ist ein weit verbreitetes Genussmittel. Es wird in Deutschland oft illegal angeboten und genutzt. Damit gefährdet es häufig die Gesundheit. Besonders Jugendliche sind durch Cannabis in ihrer sozialen und kognitiven Entwicklung beeinträchtigt. Trotzdem konsumieren immer mehr Jugendliche die Droge. Die Schwarzmarktware ist häufig verunreinigt und schafft zusätzliche Gesundheitsgefahren. Das können wir nicht länger hinnehmen. Deswegen wagen wir die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in klaren Grenzen und drängen den Schwarzmarkt zurück, flankiert durch Präventionsmaßnahmen für Jugendliche. Der Gesundheitsschutz steht dabei im Vordergrund. Die bisherige Cannabis-Politik ist gescheitert. Jetzt müssen wir neue Wege gehen.”
Bundesjustizminister Marco Buschmann ergänzt: „Der bisherige restriktive Umgang in Deutschland mit Cannabis ist gescheitert. Das Verbot von Cannabis kriminalisiert unzählige Menschen, drängt sie in kriminelle Strukturen und bindet immense Ressourcen bei den Strafverfolgungsbehörden. Es ist Zeit für einen neuen Ansatz, der mehr Eigenverantwortung zulässt, den Schwarzmarkt zurückdrängt und Polizei und Staatsanwaltschaften entlastet. Wir trauen den Menschen mehr zu– ohne dabei die Gefahren, die vom Cannabiskonsum ausgehen können zu verharmlosen.“
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sagt: „Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Eine jahrzehntelange Verbotspolitik hat davor die Augen verschlossen und damit vor allem Probleme verursacht: zulasten unserer Kinder und Jugendlichen, der Gesundheit von Konsumierenden und der Strafverfolgungsbehörden. Nun schaffen wir eine stimmige und pragmatische Cannabis-Politik aus einem Guss, vom Anbau bis zum Konsum. Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt. Durch einen kontrollierten Anbau und die Abgabe im Rahmen von Cannabis-Clubs stärken wir den Jugend- und Gesundheitsschutz. Und: Wir entziehen der organisierten Kriminalität den Boden, die selbst vor dem Verkauf an Kinder nicht zurückschreckt. Mit einem regionalen Modellprojekt loten wir zudem die Möglichkeiten einer kommerziellen Lieferkette aus.“
Modell der Cannabis Social Club
Das Modell der Cannabis Social Clubs sieht vor, dass Mitglieder mit hochwertigen Cannabisprodukten aus eigener Produktion versorgt werden, um den Schwarzmarkt auszuschließen und die Qualität für Endverbraucher zu gewährleisten. Da CSCs keinen Gewinn erzielen, sind die Kosten für Produktion und Vertrieb gering, was die Versorgung der Mitglieder vergleichsweise kostengünstig macht. Neben der Qualität ist auch der Preis ein wichtiger Faktor.
Für den Staat hätte dieses System viele Vorteile, da es den Schwarzmarkt für Cannabisprodukte bekämpfen und den Verkauf und Konsum in geschlossenen Räumen ermöglichen würde, ohne dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene Cannabis unbeabsichtigt sehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht jeder Mitglied in einem Club werden möchte und dass Gelegenheitskonsumenten lieber in einem Geschäft einkaufen. Darüber hinaus könnten CSCs nur selbstangebautes Marihuana anbieten und keine importierten Cannabisprodukte wie “gelben Libanesen”, die zur Cannabiskultur gehören.
Um den Schwarzmarkt effektiv zu bekämpfen, wäre es daher sinnvoller, eine Doppellösung mit CSCs und Hanf-Fachgeschäften zu implementieren, anstatt sich ausschließlich auf CSCs zu beschränken.

“Dachverband der Cannabis Social Clubs Deutschland” (CSCD) — Foto privat
Am 22. Oktober 2022 wurde in Berlin der “Dachverband der Cannabis Social Clubs Deutschland” (CSCD) von fast einem Dutzend deutscher Cannabis Social Clubs (CSCs) gegründet. Der CSCD hat das Ziel, den Betrieb von CSCs in ganz Deutschland zu fördern, die politischen, kulturellen und sozialen Bedürfnisse der deutschen CSCs demokratisch zu bündeln und seine Mitglieder im Dialog mit Politik, Medien und anderen gesellschaftlichen Interessengruppen zu repräsentieren. Der Verband unterstützt Mitglieder bei der Gründung und Vereinsführung von CSCs und bietet Expertise rund um den Anbau und die Weiterverarbeitung von Cannabis an. Der CSCD setzt auf einen niedrigschwelligen Ansatz sozialer Kontrolle, der durch Aufklärung und Wissensvermittlung zu einem risikobewussteren Konsum von Cannabis befähigt. Im Zuge dessen können problematische Konsummuster frühzeitig erkannt werden. Die Sprecherin von ENCOD, Gabi Kozar, betonte in ihrem Grußwort, dass CSCs in ganz Europa darauf warten, was in Deutschland geschieht, da Fehler in den Regelungen des ersten EU-Landes mit einem legalisierten Cannabismarkt sich in anderen EU-Staaten wiederholen könnten. Der CSCD plant, zeitnah einen Forderungskatalog der organisierten CannabisselbstanbauerInnen vorzustellen. Ein informelles Vorläuferpapier wurde dem Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert bereits im August auf der Hanfparade übergeben.
Wie gründe ich einen “Cannabis Social Club”?
Wenn Sie planen, einen “Cannabis Social Club” zu gründen, ist es wichtig zu beachten, dass jegliche Verbindung zum illegalen Markt vermieden werden sollte. Ein CSC sollte nicht nur den Anschein der Legalität erwecken, sondern auch legal sein und dies in einem Gerichtsverfahren nachweisen können. Deshalb ist eine strikte Disziplin in Verwaltung und Organisation notwendig.
Die Gründung des Clubs kann in vier Schritten erfolgen:
Schritt 1: Öffentliche Präsentation der Initiative zur Organisation eines “Cannabis Social Clubs” mittels einer Pressekonferenz oder öffentlichen Aktion.
Schritt 2: Gründung des Clubs durch die Auswahl von Gründungsmitgliedern, Festlegung der Regeln und Satzung sowie Eintragung des Clubs beim zuständigen Register.
Schritt 3: Anbau von Cannabis für den Eigenbedarf der Mitglieder innerhalb des geschlossenen Kreislaufs von Produktion, Verteilung und Konsum.
Schritt 4: Regelmäßige Kontrolle und Überprüfung der Einhaltung der Regeln sowie gegebenenfalls Anpassung an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen.
Es ist eine gute Idee, einen Anwalt zu kontaktieren, der Ratschläge bezüglich der zu gehenden Schritte geben kann und auf lange Sicht gegebenenfalls die rechtliche Verteidigung vorbereiten kann. Vor dem ersten Schritt sollten Sie die Rechtsgrundlagen zum Cannabiskonsum in Ihrem Land prüfen. Wenn der Konsum nicht als Straftat angesehen wird und der Besitz kleinerer Mengen für den persönlichen Gebrauch keine Strafverfolgung nach sich zieht, sollte es möglich sein, eine erfolgreiche Rechtsverteidigung für einen “Cannabis Social Club” zu organisieren. Basierend auf dem Recht der Menschen zu konsumieren, sollte es ihnen erlaubt sein, für ihren eigenen Konsum anzubauen.
Kontrollierte Abgabe von Genusscannabis an Erwachsene Eckpunkte eines 2‑Säulen-Modells:
1. Säule: Privater & gemeinschaftlicher, nicht-kommerzieller Eigenanbau
2. Säule: Regionales Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten
3. Weiteres Verfahren

News
Pelzverbot in der EU: Kommission unter Druck nach Rekord-Bürgerinitiative

Bildunterschrift: Füchse in einer Pelzfarm — Copyright: Otwarte Klatki
Stillstand in Brüssel: Warum die EU beim Pelzverbot auf Zeit spielt
Das Thema Pelz spaltet Europa – zumindest wenn man die Kluft zwischen dem Bürgerwillen und dem Handeln der politischen Institutionen betrachtet. Seit drei Jahren fordern Millionen von Menschen ein Ende der Pelztierzucht und des Pelzhandels in der Europäischen Union. Doch trotz einer historischen Bürgerinitiative und erdrückender wissenschaftlicher Fakten herrscht in der EU-Kommission ein Schweigen, das für viele Tierschützer mittlerweile unerträglich wird.
1,5 Millionen Stimmen gegen Tierquälerei
Bereits im Jahr 2023 setzte die Europäische Bürgerinitiative (EBI) „Fur Free Europe“ einen Meilenstein: Mit über 1,5 Millionen zertifizierten Unterschriften wurde eine der erfolgreichsten Bürgerinitiativen der EU-Geschichte eingereicht. Die Forderung ist klar: Ein EU-weites Verbot der Haltung und Tötung von Tieren zum Zweck der Pelzgewinnung sowie ein Verbot des Inverkehrbringens von Zuchtpelzen auf dem europäischen Markt.
Trotz dieses massiven Mandats steht eine finale Antwort der Kommission bis heute aus. Bei einer jüngsten Protestaktion des internationalen Bündnisses „Fur Free Alliance“ in Brüssel machten Organisationen wie der Deutsche Tierschutzbund erneut deutlich, dass das Ignorieren dieses demokratischen Werkzeugs das Vertrauen in die EU-Politik massiv beschädigt.
Wissenschaft und Gesundheit: Mehr als „nur“ Tierschutz
Die Argumente gegen die Pelzindustrie beschränken sich längst nicht mehr nur auf ethische Bedenken. Dr. Henriette Mackensen, Fachreferentin für Pelz beim Deutschen Tierschutzbund, betont die Komplexität der Risiken:
-
Tierschutz: Pelztiere wie Nerze und Füchse sind Wildtiere, deren Grundbedürfnisse in engen Gitterkäfigen niemals erfüllt werden können.
-
Öffentliche Gesundheit: Pelzfarmen gelten als Brutstätten für Zoonosen. Der Ausbruch von COVID-19-Mutationen auf Nerzfarmen hat gezeigt, wie gefährlich diese Haltungsformen für den Menschen sein können.
-
Umwelt: Die Verarbeitung von Pelzen erfordert den Einsatz hochgiftiger Chemikalien, um die Verwesung der Häute zu stoppen – eine enorme Belastung für Boden und Grundwasser.
Neue Umfragedaten: Ein klares Mandat der Bevölkerung
Eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsunternehmens Savanta unter 18.000 EU-Bürgern untermauert den Wunsch nach Veränderung. Die Ergebnisse für Deutschland sind dabei besonders deutlich:
| Forderung | Zustimmung (Deutschland) |
| EU-weites Verbot der Pelztierzucht | 78 % |
| Einfuhrverbot für Pelze aus Nicht-EU-Staaten | 80 % |
| Ablehnung eines Verbots | 8 % |
Diese Zahlen belegen, dass die Bürgerinitiative kein Nischenthema ist, sondern von einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit getragen wird.
Intransparenz und politische Blockaden
Kritik gibt es vor allem an der Art der Kommunikation hinter den Kulissen. Jürgen Plinz, Präsidiumsmitglied beim Deutschen Tierschutzbund, äußert den Verdacht, dass die Kommission eher das Gespräch mit der Pelzlobby sucht als mit den Vertretern der Zivilgesellschaft. Während Standards offenbar bereits mit der Industrie verhandelt wurden, blieben Gesprächsangebote von Tierschutzverbänden oft unbeantwortet.
Dieses Vorgehen nährt den Vorwurf, dass wirtschaftliche Interessen einzelner Mitgliedstaaten über das Tierwohl und den erklärten Willen der EU-Bürger gestellt werden.
Entscheidung im März: Die Stunde der Wahrheit
Nach langem Zögern wird eine offizielle Antwort der EU-Kommission nun für Ende März 2026 erwartet. Für die Tierschutzorganisationen und die 1,5 Millionen Unterzeichner ist dies der Moment der Wahrheit. Es geht nicht nur um das Schicksal von Millionen Pelztieren, sondern auch darum, wie ernst die EU ihre eigenen demokratischen Instrumente wie die Bürgerinitiative nimmt.
Ein Aufschub oder eine bloße „Optimierung“ der Haltungsbedingungen wäre aus Sicht der Initiatoren eine herbe Enttäuschung und ein fatales Signal an die Bürger.
Anzeige
Anzeige
Emder Matjes Delikatessen: Frühlingsrolle auf Apfel-Chilikompot

Emder Matjes Delikatessen: Fernöstliche Akzente in Folge 4
In der vierten Ausgabe der Serie „Emder Matjes Delikatessen“ trifft norddeutsche Tradition auf asiatische Raffinesse. Das Rezept für Frühlingsrollen vom Emder Matjes auf Apfel-Chilikompot zeigt, wie wandelbar der klassische Matjes ist und wie harmonisch er mit exotischen Aromen harmoniert.
Wenn zarte Emder Matjesfilets auf Mango, Ingwer und Sojasauce treffen, entsteht eine Vorspeise, die den Gaumen überrascht. Die Kombination aus der Salzigkeit des Matjes, der fruchtigen Süße der Mango und der leichten Schärfe des Ingwers verleiht dem Gericht eine moderne, süßsaure Note. Eingehüllt in knusprigen Frühlingsrollenteig, wird der Fisch zu einem völlig neuen Erlebnis.
Das Rezept: Knuspriger Matjes trifft fruchtiges Kompott
Für vier Personen bildet das Zusammenspiel aus Textur und Temperatur das Herzstück dieses Gerichts. Während die Frühlingsrollen heiß serviert werden, sorgt das selbstgemachte Apfel-Chilikompot für eine fruchtig-pikante Basis.
Zutaten für die Frühlingsrollen
-
4 Emder Matjesfilets
-
½ Mango, ½ rote Paprika, 1 rote Zwiebel
-
50 g Sojasprossen, 4 Stangen grüner Spargel
-
10 g Ingwer, 2 cl Sojasauce
-
Koriander, Salz, Pfeffer, Zucker
-
4 Blatt Frühlingsrollenteig & 1 Eiweiß
Zutaten für das Apfel-Kompott
-
3 Äpfel, ½ Zwiebel, ½ rote Chilischote
-
100 g Zucker, 2 EL Essig, 50 g Butter
-
Apfelsaft, Salz, Pfeffer
Schritt für Schritt zur maritimen Vorspeise
-
Die Füllung: Matjesfilets, Mango, Spargel, Paprika und Zwiebeln in feine Würfel schneiden. Mit gehacktem Koriander vermengen und mit Sojasauce sowie frisch geriebenem Ingwer abschmecken.
-
Das Rollen: Den Teig auslegen, Ränder mit Eiweiß bestreichen, Füllung platzieren und die Seiten eingeschlagen fest aufrollen.
-
Das Kompott: Zucker karamellisieren, gewürfelte Äpfel, Zwiebeln und Chili hinzugeben und mit Apfelsaft ablöschen. Etwa 5 bis 7 Minuten köcheln lassen und mit Butter verfeinern.
-
Das Finale: Die Rollen bei 180°C etwa 3 Minuten goldbraun ausbacken. Das Kompott mittig auf einem tiefen Teller anrichten und die Frühlingsrolle darauf platzieren.
Kulinarischer Tipp: Für das perfekte Finish und eine zusätzliche Textur eignen sich Wasabi-Erbsen und Krabbenchips hervorragend als Garnitur.

Anzeige
Werte schaffen. Energiekosten senken. Fürs Alter vorsorgen. Jetzt loslegen.

Clever ins Eigenheim investieren – Werte schaffen, Energiekosten senken, fürs Alter vorsorgen. Jetzt loslegen.
Wer heute in sein Zuhause investiert, denkt weiter als nur bis zur nächsten Renovierung. Es geht um Werterhalt, um nachhaltige Kostensenkung und um eine solide Altersvorsorge. Genau hier setzt Finanzierungsexperte Sven Albert aus Leer an. Als BauWoLe-Partner verbindet er Eigenheimbesitzer mit dem passenden Handwerk – und sorgt dafür, dass Ihr Projekt auf einem stabilen finanziellen Fundament steht.
Ob neue Küche, Wintergarten, Auffahrt, Wärmedämmung oder moderne Heizungsanlage: Jede Maßnahme steigert Komfort und Immobilienwert. Besonders energetische Sanierungen zahlen sich langfristig aus – durch deutlich geringere Energiekosten und eine höhere Unabhängigkeit von Preissteigerungen.
Ganzheitlich planen statt Stückwerk finanzieren
Sven Albert empfiehlt, Modernisierungen nicht isoliert zu betrachten. Wer beispielsweise eine neue Küche plant, sollte auch angrenzende Gewerke realistisch mit einkalkulieren:
-
Erneuerung der Elektrik
-
modernes Beleuchtungskonzept
-
neue Wand- und Bodenfliesen
-
notwendige Malerarbeiten
Oft entstehen genau hier zusätzliche Kosten, die im ersten Moment unterschätzt werden. Eine durchdachte Finanzierung berücksichtigt deshalb nicht nur die Hauptinvestition, sondern das gesamte Projektumfeld.
Sein Rat: Lieber einen finanziellen Puffer einplanen. Unerwartete Mehrkosten lassen sich so souverän abfangen, ohne dass Ihre Kalkulation ins Wanken gerät.
Mehrere Projekte bündeln – effizienter und oft günstiger
Nicht selten lohnt es sich, zwei oder sogar drei Maßnahmen in einem Zug zu finanzieren. Wer beispielsweise die Küche modernisiert, kann gleichzeitig die Elektrik auf den neuesten Stand bringen oder angrenzende Räume renovieren.
Das Ergebnis:
-
nur eine Bauphase
-
bessere Abstimmung der Gewerke
-
häufig günstigere Gesamtkonditionen
-
schnellerer Abschluss der Arbeiten
Denn Hand aufs Herz: Wer möchte schon dauerhaft auf einer Baustelle wohnen?
Werte sichern – Zukunft gestalten
Jede Investition ins Eigenheim ist auch eine Investition in Ihre Zukunft. Modernisierungen erhöhen die Lebensqualität, steigern den Immobilienwert und sorgen dafür, dass größere Sanierungen im Rentenalter bereits abgeschlossen sind.
Wer heute in Dämmung, effiziente Heiztechnik oder hochwertige Ausstattung investiert, reduziert langfristig Betriebskosten und schafft finanzielle Entlastung für später.
Ihr starker Partner in Leer
Sven Albert begleitet Sie mit Erfahrung, Marktkenntnis und einem klaren Blick für wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. Als BauWoLe-Partner bringt er Handwerk und Finanzierung zusammen – strukturiert, planbar und transparent.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Ihr Projekt strategisch anzugehen.
Mit einer cleveren Finanzierung schaffen Sie Werte, senken Energiekosten und sorgen nachhaltig fürs Alter vor.
Seriöse Finanzierung – direkt vor Ort mit persönlicher Beratung
Bei Sven Albert haben Sie einen kompetenten Partner an Ihrer Seite – gemeinsam mit der traditionellen Bausparkasse Schwäbisch Hall. Hier bauen Sie eine seriöse, solide Finanzierung auf, die genau auf Ihre Wohnträume und Pläne zugeschnitten ist. Schon bevor Sie mit der Renovierung, dem Anbau oder der Modernisierung Ihres Eigenheims beginnen, können Sie die Finanzierung in trockenen Tüchern haben.
Sie wissen von Anfang an, welchen Finanzierungsrahmen Sie haben, können Puffer für unerwartete Mehrkosten einplanen und alle verfügbaren Fördermöglichkeiten optimal nutzen. Anders als bei anonymen Callcentern haben Sie hier einen direkten Ansprechpartner aus Ostfriesland, der Sie persönlich begleitet, auf Ihre Fragen eingeht und Sie Schritt für Schritt unterstützt.
Sven Albert verfügt über langjährige Erfahrung mit Neubau- und Modernisierungsprojekten und ein großes Netzwerk an Bau- und Handwerkspartnern. So können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt professionell geplant, finanziert und umgesetzt wird – ohne böse Überraschungen. Ein Beratungsgespräch ist unverbindlich und kostenfrei und sollte frühzeitig als erster Schritt genutzt werden, damit alle weiteren Maßnahmen auf einer sicheren Basis starten können. So wird Ihr Eigenheimtraum von Anfang an Realität – entspannt, planbar und abgesichert.
Kontaktieren Sie Sven Albert – Ihr persönlicher Berater vor Ort
Sven Albert
Selbstständiger Berater
Mobil: 01522 / 2686457
Telefon: 0491 / 20340108
E‑Mail: sven.albert@schwaebisch-hall.de
Neues Büro in 26789 Leer:
Heisfelder Str. 111 a
Tel: 0491 / 20340108