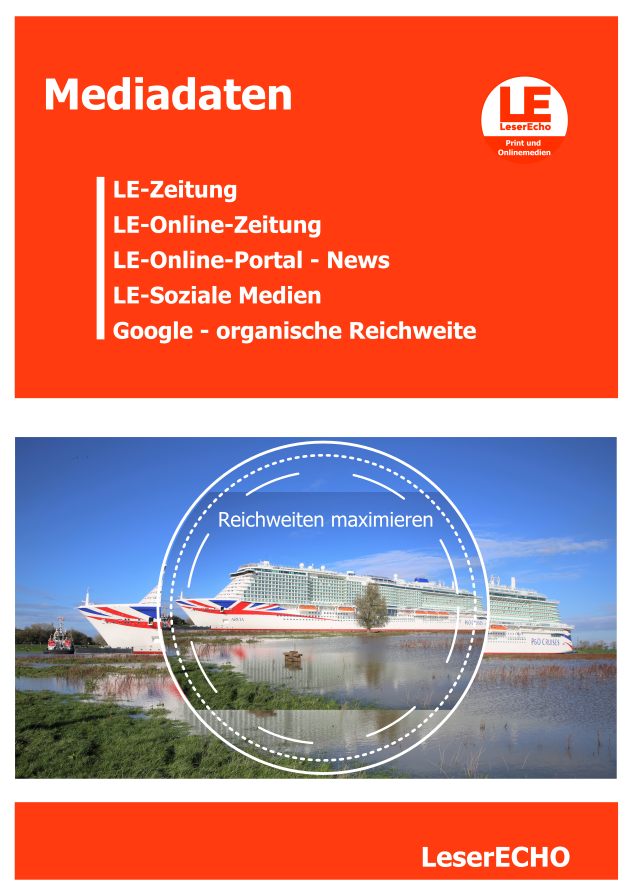Lokal
EWE muss Strom- und Gaspreis in Grundversorgung zu Januar anheben

- Kundenzuwachs und weiter angespannte Marktlage bedingen teure Beschaffung
- Gestiegene Netzentgelte machen Strom zusätzlich teurer
- EWE begrüßt staatliche Energiepreis-Entlastung für Kunden
- EWE refinanziert über Alterric auch Entlastungspaket der Bundesregierung
- Auch in Energiekrise steht EWE für Versorgungssicherheit
Oldenburg, 4. November 2022. Zum Jahreswechsel ist EWE erneut gezwungen, seine Strom- und Gaspreise in der Grundversorgung anzuheben. Betroffen sind davon etwa 331.000 Strom- und 180.000 Gaskunden. So zahlen Kunden ab dem 1. Januar für Strom pro Kilowattstunde brutto 49,97 Cent und damit 12,16 Cent mehr als derzeit. Der jährliche Grundpreis steigt von brutto 179,69 Euro auf brutto 199,55 Euro. Das sind im Monat statt bislang 14,97 Euro dann 16,63 Euro brutto. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.800 Kilowattstunden ergeben sich durch die Preisanhebung insgesamt Mehrkosten von rund 30 Euro im Monat.
Diese Strompreisanpassung gilt nicht in Brandenburg, da EWE dort kein Strom-Grundversorger ist.
Der Gaspreis steigt in der Grundversorgung pro Kilowattstunde von aktuell brutto 13,55 Cent auf 17,47 Cent. Das entspricht einem Plus von 3,92 Cent pro Kilowattstunde. Der jährliche Grundpreis ändert sich bei Gas marginal und steigt von 180 Euro auf 182,28 Euro. Das sind im Monat statt bislang 15 Euro dann 15,19 Euro. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahlt durch die Preisanhebung insgesamt pro Monat gut 65 Euro mehr als bislang.
Kundenzuwachs, weiter angespannte Marktlage und Netzentgelte sind Gründe für Preisanstieg
Die Gründe für die erneute Preisanhebung erläutert Oliver Bolay, Geschäftsführer der EWE VERTRIEB GmbH: „EWE hat auch weiterhin einen enormen Kundenzuwachs zu verzeichnen und gleichzeitig fast keine Kundenverluste – sowohl beim Gas als auch beim Strom. Im Vergleich zur letzten Preisanpassung im Oktober ist nochmal die Anzahl der Gaskunden in der Grundversorgung stark gestiegen. Der Grund für die Kundenzuwächse: Immer mehr Kunden aus dem EWE-Heimatmarkt, die zu Wettbewerbern gewechselt waren, kündigten auch in diesem Jahr dort ihre Sonderverträge, die im Vergleich zur EWE-Grundversorgung teurer waren, und wechselten wieder in die EWE-Grundversorgung. Der Trend hält auch weiterhin an. Für diesen schwer zu kalkulierenden Kundenzuwachs muss EWE zu den aktuellen Preisen Energie am Markt nachkaufen, während EWE für seine Bestandskunden die Energie bereits langfristig eingekauft hat. Die teure Nachbeschaffung von Strom und Gas aber treibt den Preis für alle grundversorgten Kunden in die Höhe“, sagt Bolay. Auch für Bestandskunden müsse EWE zunehmend teurer einkaufen. Daran ändere auch eine witterungsbedingte Momentaufnahme im Oktober nichts, die den Gaspreis kurzfristig sinken ließ. Beim Strompreis komme hinzu, dass die „deutlich gestiegenen Netzentgelte“ den Strompreis zusätzlich nach oben trieben. Die Netzentgelte machen Bolay zufolge einen Anteil von rund 17 Prozent am Strompreis aus.
Ersatzversorgung bei EWE zum 1. Dezember teurer als Grundversorgung
Kunden aus dem EWE Heimatmarkt, die zu EWE zurückkehren, weil ihr bisheriger Versorger Insolvenz anmelden musste, überführt EWE gesetzeskonform zunächst in die Ersatzversorgung, und zwar für maximal drei Monate. Der Preis der Ersatzversorgung richtet sich bei EWE zum 1. Dezember – wie auch bei anderen Versorgern – nach den aktuellen Beschaffungskosten.
EWE begrüßt staatliche Entlastung der Kunden
EWE ist sehr wohl bewusst, dass die kriegsbedingte Energiekrise samt steigender Preise viele private Haushalte, aber auch Unternehmen wirtschaftlich überfordert. EWE begrüßt daher ausdrücklich, dass die Bundesregierung Energiekunden entlasten möchte.
Der EWE-Vorstandsvorsitzende Stefan Dohler kommentiert jedoch die aktuellen politischen Vorgaben für die Umsetzung wie folgt: „Die Entlastung der Kundinnen und Kunden ist ohne Frage dringend nötig und von EWE seit Monaten gefordert. Die Versorger müssen das aber auch umsetzen können. In wenigen Wochen, noch ohne vorliegende gesetzliche Grundlage, für alle Gas‑, Fernwärme- und Stromkunden komplexe Anpassungen in den Abrechnungsprozessen umzusetzen, diese in den Systemen zu programmieren, zu testen und dann für Strom mit Wirkung zum 1. Januar 2023 anzuwenden, wird vielfach faktisch unmöglich sein. Das ist eine Zumutung der Politik, die über ein Aussetzen der Abschläge für Strom im Januar, wie im Dezember beim Erdgas, eine einfache Alternative hätte, die auch dem Realitätscheck standhält und den Wintereffekt bis März kompensiert. Der Staat könnte auch ein weiteres Mal ein Energiegeld auszahlen. Ab März wirkt dann die reguläre Preisbremse. Es stellt sich schon die Frage, wozu es eine Expertenkommission gab, wenn sich Politik nun rigoros über deren Empfehlungen hinwegsetzt?“
Auch EWE füllt über Beteiligung an Alterric Entlastungstopf der Bundesregierung
EWE macht im Zusammenhang mit dem staatlich vorgesehenen Entlastungspaket darauf aufmerksam, dass dieses nicht nur aus Steuergeldern finanziert wird, sondern auch durch die geplante Abschöpfung von Unternehmensgewinnen. So wird auch EWE als breit aufgestelltes Energieunternehmen über seine Beteiligung am Grünstromerzeuger Alterric, der einen signifikanten Beitrag für den Ausbau der Windenergie an Land leistet, mit einem Teil des dort erzielten Gewinns dazu beitragen, das staatliche Entlastungspaket zu refinanzieren. Damit werden jedoch der Alterric für den zügigen Ausbau der Windenergie dringend erforderliche Investitionsmittel entzogen.
EWE sorgt auch in Krise für Versorgungssicherheit in der Region
Für EWE-Kunden gilt, dass sie sich auch in der aktuellen Energiekrise auf EWE verlassen können. Es hat für EWE derzeit oberste Priorität, die Versorgungssicherheit trotz weggefallener russischer Erdgasmengen sicherzustellen. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden die Krisenstäbe aktiviert, die seither im engen Dialog mit Behörden und Verbänden stehen. Das Ziel: Eine etwaige Mangellage und damit die zeitweise Unterversorgung von Erdgaskunden mit aller Kraft zu verhindern. In dem Zusammenhang bleibt das Einsparen von Energie oberstes Gebot.
Aktuell sind die Erdgasspeicher von EWE zu 100 Prozent gefüllt und der Nordwesten in der aktuellen Situation damit bestmöglich für die bevorstehende Heizperiode gerüstet. Ab dem Jahreswechsel sollen die an Deutschlands Küsten geplanten Flüssiggasterminals neue Gasmengen ins Land bringen. EWE engagiert sich bei der Netzanbindung des LNG-Terminals Wilhelmshaven, damit ein Teil des ankommenden Erdgases in der Region gespeichert und auch verbraucht werden kann. Weil der Leitungsneubau später grünen Wasserstoff transportieren wird, entsteht hier mitten in der Krise ein wesentlicher Grundstein für eine nachhaltige, dezentrale, sichere und klimafreundliche Energieversorgung. Um diese Aufgaben stemmen zu können ist EWE auf eine stabile wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angewiesen.


Lokal
Friseurhandwerk: Neue gesetzliche Maßnahmen gegen Schwarzarbeit und unlauteren Wettbewerb

„Wir wollen fairen Wettbewerb“: Friseurhandwerk dankt Gitta Connemann für Einsatz gegen Schwarzarbeit
WEENER / HOLTHUSEN – Friseurmeister Heiner Heijen ist in Ostfriesland eine Institution. Seit fast 60 Jahren stehen seine Familie und er für hervorragendes Handwerk. Die Leidenschaft, die Vater Gerhard Heijen in den 1960er Jahren mit einem Salon in Weener-Holthusen begründete, führen heute Tochter Silke Heijen-Bertram und Sohn Heiner fort.
Heiner Heijen engagiert sich weit über den eigenen Betrieb hinaus ehrenamtlich für das Handwerk. Als Kreishandwerksmeister sowie Obermeister und stellvertretender Landesinnungsmeister gibt er dem Friseurhandwerk landesweit Gesicht und Stimme. Im Namen der mehr als 80.000 Branchenangehörigen dankte er nun der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann für ihren maßgeblichen Einsatz gegen Schwarzarbeit.
Aufnahme in das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
Das Friseur- und Kosmetikhandwerk ist wie kaum eine andere Branche von illegaler Beschäftigung betroffen. Auf ausdrücklichen Wunsch der Betriebe wurde das Gewerbe mit der Novelle des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes nun in den Katalog der Schwerpunktbranchen aufgenommen. Gitta Connemann hatte sich dafür in den politischen Verhandlungen intensiv stark gemacht – mit Erfolg.
Zusammen mit Bürgermeister Heiko Abbas besuchte die Abgeordnete Heijen in seinem Salon „Art Frisör“ in Holthusen. „Ehrliche Betriebe verlieren durch Schwarzarbeit Aufträge, Arbeitsplätze sind gefährdet und dem Staat entgehen Abermilliarden an Einnahmen“, betonte Connemann vor Ort. „Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Schlag ins Gesicht derer, die täglich Verantwortung übernehmen und ihre Steuern zahlen.“
Klare Regeln für fairen Wettbewerb
Das Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung schafft einen Rahmen, um Bürokratie abzubauen und gezielt dort einzugreifen, wo Schwarzarbeit floriert. Für Friseursalons, Barbershops und Nagelstudios bedeutet die Einstufung als Schwerpunktbranche künftig strengere Vorgaben:
-
Mitführungspflicht des Ausweises für Beschäftigte
-
Sofortmeldung neuer Mitarbeiter
-
Ordentliche Erfassung der Arbeitszeiten
-
Saubere Kassenführung
Heiner Heijen und seine Kollegen begrüßen diese Schritte ausdrücklich. „Wir wollen zeigen, dass wir sauber arbeiten. Wir wollen fairen Wettbewerb und gleiche Regeln für alle“, stellt der Obermeister klar.
Rückenwind für das regionale Handwerk
Auch Bürgermeister Heiko Abbas sieht in der Gesetzesänderung einen Gewinn für die Kommune: „In unserer Stadt gibt es viele innovative Handwerksbetriebe, die mit Leidenschaft geführt werden. Es ist wichtig, dass sie gegen unlauteren Wettbewerb geschützt werden.“
Für Gitta Connemann bleibt das Ziel klar: Denjenigen den Rücken zu stärken, die als „Künstler des Alltags“ den Menschen Selbstbewusstsein schenken. Durch die neuen gesetzlichen Maßnahmen erhält das Friseurhandwerk nun den Schutz vor Wettbewerbsverzerrung, den es für eine sichere Zukunft benötigt.
Anzeige
Die Inhaber Isaac Abdullah und Hauar Abdullah sowie das gesamte Team freuen sich darauf, die Gäste in den neuen Räumlichkeiten willkommen zu heißen.

Lokal
Kunsthaus Leer: Schüler des TGG und UEG präsentieren ostfriesische Landschaften

Ostfriesische Landschaften: Kunsthaus Leer zeigt Schülerarbeiten
Leer – Vom 20. bis zum 22. Februar wird das Kunsthaus Leer zum Schauplatz einer besonderen Begegnung zwischen etablierter Kunst und jungen Talenten. Unter dem Titel „Ostfriesische Landschaften“ werden Arbeiten von Schülerinnen und Schülern des Teletta-Groß- und des Ubbo-Emmius-Gymnasiums präsentiert. Die Werke sind das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit der aktuellen Ausstellung „Sammlungspräsentation. Neue Werke II“, die Bilder namhafter Künstler wie Hilke Deutscher, Herbert Müller, Ahlrich van Ohlen und Uwe Schierholz zeigt.
Dem Thema „Landschaft“ des laufenden Schulhalbjahres entsprechend, widmeten sich die Teilnehmenden des Kunstleistungskurses unter der Leitung der Lehrerin Barbara von Kameke gezielt ostfriesischen Darstellungen. Inspiriert von den Werken Deutschers und Müllers skizzierten die Jugendlichen vor Ort ihre Eindrücke, um diese im anschließenden Unterricht in eigenständige Kompositionen zu überführen.
Das Ergebnis sind 19 beeindruckende Bilder in den Techniken Aquarell, Acryl, Öl und Linoldruck. Diese werden am 21. und 22. Februar jeweils von 14 bis 17 Uhr Seite an Seite mit den Werken der professionellen Künstler gezeigt. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, den 20. Februar, um 16 Uhr statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich ein Bild von der kreativen Schaffenskraft der regionalen Schüler zu machen.
Anzeige
Lokal
Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi diskutiert ärztliche Versorgung in Bunde

Gesundheitsminister Philippi in Bunde: Lösungsansätze gegen den Hausärztemangel
Bunde. Die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum bleibt eine der drängendsten Aufgaben der Landespolitik. Bei einer gut besuchten Diskussionsveranstaltung in der Dorfgemeinschaftsanlage Bunde verdeutlichte Niedersachsens Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi vor rund 120 interessierten Bürgern und Fachleuten, dass eine reine Erhöhung der Arztquote allein nicht ausreichen wird. Neben mehr Medizinern forderte der Minister vor allem eine effizientere Steuerung der Patientenströme.
Eingeladen hatten die SPD-Bundestagsabgeordnete Anja Troff-Schaffarzyk und der Landtagsabgeordnete Nico Bloem. Letzterer betonte bereits zur Begrüßung die hohe emotionale Relevanz des Themas: Der Mangel belaste nicht nur die Patienten, sondern führe auch bei Ärzten und Praxisbelegschaften zu einer massiven Überlastung.
Bessere Steuerung und digitale Unterstützung
Minister Philippi räumte ein, dass aufgrund der Überalterung der Ärzteschaft und veränderter Berufseinstellungen – weg von der 80-Stunden-Woche, hin zu einer besseren Work-Life-Balance – mehr Mediziner ausgebildet werden müssen. Ein zentrales Problem sieht er jedoch in der hohen Frequenz der Praxisbesuche. „Es ist entscheidend, dass wir den Erstkontakt verbessern. Mit einer besseren Steuerung können wir die Zahl der Besuche deutlich verringern“, so Philippi.
Als Schlüssel zur Entlastung nannte er:
-
Telemedizin und KI: Einsatz moderner Technologien zur Vorab-Diagnose und Beratung.
-
Bürokratieabbau: Reduzierung des administrativen Aufwands, damit wieder mehr Zeit für die Patienten bleibt.
-
Kooperation: Eine enge Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), um die Strukturen zukunftsfähig zu machen.
Trotz der bekannten Schwachstellen hielt der Minister fest: „Wir haben ein exzellentes Gesundheitssystem. Das muss an dieser Stelle auch einmal gesagt werden.“
Deutliche Kritik aus der Ärzteschaft
In der anschließenden Diskussion nahmen die anwesenden Mediziner kein Blatt vor den Mund. Sie kritisierten scharf, dass in den vergangenen Jahrzehnten versäumt wurde, ausreichend Studienplätze zu schaffen. Zudem schilderten sie eindringlich, wie unklare Zuständigkeiten und überbordende Bürokratie den Praxisalltag lähmen und wertvolle Behandlungszeit kosten.
Nico Bloem versprach zum Abschluss der Veranstaltung, das Thema weiterhin mit hoher Priorität zu verfolgen: „Mich treibt die ärztliche Grundversorgung sehr um. Wir wissen um die Herausforderungen und müssen diese gemeinsam anpacken.“ Er unterstrich sein Ziel, eine verlässliche Versorgung im Wahlkreis dauerhaft sicherzustellen.
Anzeige Anzeige