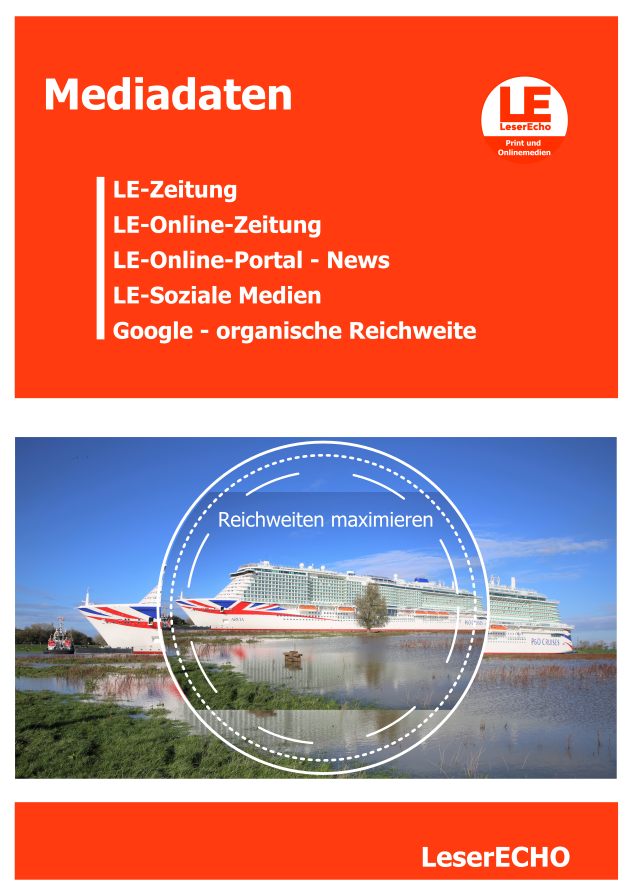News
Häufig gestellte Fragen zum Winterdienst

1. Was ist Winterdienst?
Winterdienst heißt, dass auf öffentlichen Straßen und Wegen im Rahmen der Möglichkeit Schnee geräumt und Glätte bekämpft wird.
Es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Qualität. Bei Schnee und Glätte handelt es sich um Naturereignisse, die nur im gewissen Rahmen vorhersehbar sind.
2. Was bedeutet „im Rahmen der Möglichkeit“?
In vielen Rechtsvorschriften finden wir den Begriff “nach besten Kräften”. Nach besten Kräften beinhaltet einerseits das was zumutbar bzw. finanzierbar ist und andererseits das was auch naturgegeben möglich ist. Es gibt sehr viele Urteile, die sich mit Grundsatz- und Einzelfragen befasst haben.
Für die Außerortsstraßen (häufig Bundes‑, Landes- und Kreisstraßen) gibt es eine Vorgabe, wie das Anforderungsniveau aussehen soll. Auf dieser Grundlage erhalten die Straßenbauverwaltungen Personal, Geräte und Geldmittel zur Erfüllung der Aufgaben bereitgestellt.
3. Wie genau sieht das Anforderungsniveau aus? Was darf der Verkehrsteilnehmer erwarten?
Es gibt zum einen die zeitliche Komponente. Auf Autobahnen soll rund um die Uhr Winterdienst sichergestellt werden. Auf allen anderen wichtigen Straßen für den überörtlichen Verkehr mit starkem Berufsverkehr oder Linienbusverkehr soll der Winterdienst so stattfinden, dass die Straßen täglich zwischen 6 und 22 Uhr befahrbar sind.
Alle anderen überörtlichen Straßen, Geh- und Radwegen außerhalb der Ortschaften werden nachrangig nach dem örtlichen Verkehrsbedürfnis behandelt.
Unter Umständen sind unsere Kolleginnen und Kollegen in wechselnden Schichten an 7 Tagen fast rund um die Uhr im Einsatz.
Die zweite Komponente betrifft die jeweilige Wetterlage. Bei Schneefall, Eis- und Reifglätte sollen die Straßen befahrbar sein. Bei starkem und lang anhaltendem Schneefall soll wenigstens je Richtung ein Fahrstreifen, notfalls mit Schneeketten befahrbar sein.
Bei starken Schneeverwehungen, Lawinen oder Eisregen kann die Befahrbarkeit nicht mehr sichergestellt werden.
4. Gibt es unterschiedliche Arten der Glätte?
Wir unterscheiden zwischen Reifglätte, Eisglätte, Glatteis und Schneeglätte. Reifglätte entsteht durch die Feuchtigkeit (Nebel, Dunst) aus der Luft, die sich auf der ursprünglich trockenen Fahrbahn niederschlägt. Eisglätte entsteht durch Überfrieren der nassen Fahrbahn und Glatteis durch gefrierenden Regen.
Die Glättebildung hängt aber auch immer mit den örtlichen Verhältnissen zusammen. Sonneneinstrahlung und Verschattung, die Windverhältnisse oder Mulden und Senken sowie exponierte Lagen spielen eine große Rolle.
5. Was heißt Befahrbarkeit?
Die Befahrbarkeit einer Straße bedeutet, dass Behinderungen durch Schneereste oder je nach Wetterlage und Einsatzdauer des Winterdienstes stellenweise auch mit geschlossener Schneedecke gerechnet werden muss. Auch kann stellenweise Reif- und Eisglätte nicht ausgeschlossen werden.
6. Was kann ich als Verkehrsteilnehmer tun?
Von allen Verkehrsteilnehmern wird erwartet (laut Straßenverkehrsordnung), dass auch mit einer den Witterungsverhältnissen angepassten Geschwindigkeit und der passenden Winterbereifung gefahren wird, für Fußgänger entsprechendes Schuhwerk
7. Wer muss in den Ortschaften bei Schnee räumen und bei Glätte streuen?
In den Ortschaften ist auf allen Straßen die Gemeinde oder Stadt zuständig. Schnee zu räumen oder bei Glätte zu streuen bzw. abzustumpfen gehört zur sogenannten Reinigungspflicht. Die Gemeinden oder Städte übertragen diese Aufgabe per Satzung teilweise auf die Anlieger. Die Straßenreinigungssatzungen findet man in der Regel im Internet. Meistens sind die Anlieger für die Gehwege zuständig, manchmal auch für die Straße.
Bei Hauptverkehrsstraßen und insbesondere Durchgangsstraßen (Bundes‑, Landes- oder Kreisstraßen) sind in den meisten Fällen die Gemeinden oder Städte für die Reinigung, also auch den Winterdienst, auf den Fahrbahnen und Radwegen zuständig.
Vielfach gibt es Vereinbarungen mit der Straßenbauverwaltung, dass diese Straßen mit geräumt und gestreut werden, weil die Fahrzeuge ohnehin dort entlang fahren müssen.
8. Darf ich den Schnee vom Gehweg auf die Straße schieben?
Wenn auf den Gehwegen nicht genug Platz vorhanden ist um den Schnee aufzuhäufen, muss der Schnee auf dem eigenen Grundstück untergebracht werden. Jedenfalls gehört er nicht auf die Straße. Das nächste Räumfahrzeug wird den Schnee sonst unweigerlich wieder auf den Gehweg schieben.
9. Woher weiß die SBV wann es glatt wird oder schneit?
Der Straßenbauverwaltung (SBV) stehen für die Wetterinformationen professionelle Wettermeldungen des Deutschen Wetterdienstes zur Verfügung. Diese sogenannten SWIS-Meldungen geben uns eine Vorschau auf den nächsten Tag. Neben den Lufttemperaturen und den zu erwartenden Niederschlag erhalten wir beispielsweise auch Informationen über die Bodentemperaturen und die Luftfeuchtigkeit. Natürlich gehören auch aktuelle Karten dazu, die beispielweise konkret die Niederschläge als Regen oder Schnee zeigen.
An einigen Stellen im Straßennetz haben wir noch sogenannte Glättemeldeanlagen. Zusätzlich zu diesen Möglichkeiten sind insbesondere in der Nacht Kolleginnen und Kollegen unterwegs, um an neuralgischen Punkten das lokale Wetter zu beurteilen.
10. Wann beginnt der Winterdienst mit der Arbeit?
Je nach Wettervorhersage wird der Winterdiensteinsatz entweder gleich für den frühen Morgen angeordnet oder aber die Kolleginnen und Kollegen warten in Rufbereitschaft zuhause auf einen Einsatz. Damit ab 6 Uhr die Straßen befahrbar sind, startet der Winterdienst meistens schon gegen 3 Uhr in der Früh.
Die Wettermelder sind oft schon ab 1 Uhr nachts unterwegs, um bei Bedarf einen Einsatz auslösen zu können. Auch die Einsatzleitzentrale der Polizei steht mit der Straßenmeisterei in Verbindung und informiert uns bei Bedarf.
11. Wann muss man im Tagesverlauf am ehesten mit Glätte rechnen?
Die größte Wahrscheinlichkeit, dass sich Glätte bildet, ist in den frühen Morgenstunden um den Sonnenaufgang herum, denn zu dieser Zeit sind die Temperaturen häufig am niedrigsten.
12. Wie viele Fahrzeuge hat eine Straßenmeisterei für den Winterdienst?
Je nach Größe der Straßenmeisterei werden zwischen 8 und 10 Bezirke betreut. Jede Straßenmeisterei verfügt über 3 oder 4 eigene Winterdienstfahrzeuge. Darüber hinaus werden Firmen beauftragt, die uns mit 3 bis 6 Fahrzeugen unterstützen.
Für jedes Fahrzeug gibt es einen Bezirk, der betreut werden soll. Dieser wurde so optimiert, dass möglichst wenige Leerfahrten (Abschnitte, die bereits von anderen Fahrzeugen bearbeitet wurden bzw. die Rückfahrt zum Stützpunkt) entstehen.
13. Wie groß sind die Bezirke?
Die durchschnittlich zu bearbeitende Streckenlänge der Bezirke für Streu- und Räumeinsätze beträgt etwa 45 km. Insgesamt legen die Fahrzeuge 70 bis 80 km pro Umlauf zurück, bis sie wieder im Stützpunkt angelangt sind.
14. Wie lange dauert ein „Umlauf“?
Ein Streuumlauf dauert etwa 2,5 bis 3,5 Stunden. Damit wird der Zeitraum bezeichnet, den ein Fahrzeug benötigt, um einmal seinen Bezirk abzufahren, zurückzukehren und dann wieder beladen für den nächsten Einsatz bereit zu stehen. Im Normalfall reichen das geladene Salz und auch die Salzsole für einen Umlauf aus.
Wenn auch Schnee geräumt werden muss, verlängern sich die Umlaufzeiten. Beim Räumen kann der Schnee immer nur auf einer Fahrspur geschoben werden, während beim Streuen in der Regel zwei Fahrspuren gleichzeitig bedient werden können.
Die Fahrzeuge fahren mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 25 bis 35 km/h. Besonders beim Räumen kommt es auf die richtige Geschwindigkeit an. In Ortschaften wird versucht, gerade so schnell zu fahren, dass die Straße frei wird, aber der Schnee nicht auf die Grundstücke fliegt.
15. Womit wird gestreut?
Am besten hat sich sogenanntes Feuchtsalz (FS 30) bewährt. Dabei wird normales Kochsalz (NaCl, Natriumchlorid) ausgestreut und mit 30 % Salzsole (20%ige Lösung) angefeuchtet. Durch die Salzsole haftet das Salz auf der Straße und wird nicht so schnell durch den Fahrtwind fortgeweht. Außerdem löst sich das angefeuchtete Salz schneller auf und kann seine Wirkung früher entfalten.
Auf den Autobahnmeistereien kann bei entsprechenden Witterungslagen zusätzlich zu der FS-30-Streuerung auch die reine Solesprühung (FS 100) erfolgen. Bei der reinen Solesprühung handelt es sich um eine Ergänzung des Winterdienstes bei den Präventivmaßnahmen und bei Fahrbahntemperaturen bis — 6°C.
Kleiner physikalischer Exkurs:
Wenn sich Salz im Wasser auflösen soll, ist dazu Energie notwendig. Die Energie dazu kommt aus der Umgebung in Form von Wärme, die dem Boden, der umliegenden Luft oder dem Wasser entzogen wird. Die Temperaturen insbesondere des Wassers können dadurch sogar unter 0 Null Grad sinken und es kann gefrieren.
Der Prozess des Auflösens wird beschleunigt, wenn schon Salz im Wasser gelöst ist.
Auch der fließende Verkehr trägt wesentlich zum Auftauprozess bei. Das gelöste Salz (Salzsole) wird vermischt, ähnlich wie beim Rühren in Glas. Durch das Walken der Reifen entsteht zusätzliche Wärme. Das lässt sich gut anhand von Strecken mit Überholfahrstreifen beobachten. Während der Hauptfahrstreifen oft schon gut abgetaut ist, sieht der Überholfahrstreifen oft noch weiß aus.
Deshalb: Achtung — gestreute Straßen können noch glatt sein!
16. Gibt es Besonderheiten im Winterdienst bei Radwegen?
Radwege außerhalb der Ortschaften können häufig erst nachrangig im Winterdienst behandelt werden. Insbesondere nach Schneefällen muss erst die Fahrbahn neben dem Radweg geräumt sein, damit nicht der bereits geräumte Radweg wieder zugeschüttet wird. Auch die verfügbaren Ressourcen spielen eine Rolle, da pro Straßenmeisterei nur ein spezielles Gerät für Radwege zur Verfügung steht.
Ein anderer Umstand hat ebenfalls große Bedeutung — auf den Radwegen fehlt die wichtige, unterstützende Wirkung des Verkehrs. Das rollende Rad hilft bei der Verteilung des Salzes und fördert das Auftauen. Selbst gestreute oder geräumte Radwege können also noch lange glatt sein.
17. Wieviel Salz wird gestreut? Wie schnell fahren die Fahrzeuge?
Die Fahrzeuge bringen das Streusalz mit sogenannten Streuautomaten aus. Die Menge an Streusalz beträgt zwischen 5 und 40 g/m² und wird unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit gesteuert.
Die Fahrzeuge können zwischen 2,5 und 5,0 m³ Salz laden und führen zwischen 1.200 und 2.400 Litern Salzsole mit sich. Zusammen entspricht das einer Nutzlast von 4,2 bis 8,1 t.
18. Was kann man vorsorglich (präventiv) tun?
Mit dem Schneeräumen kann natürlich erst begonnen werden, wenn der Schneefall eingesetzt hat. Durch die Wetterbeobachtungen und professionellen Wettervorhersagen können die Fahrzeuge allerdings rechtzeitig in Bereitschaft versetzt werden und zum richtigen Zeitpunkt mit einsetzendem Schneefall losfahren.
In Bezug auf Glätte können wir zum Teil vorbeugend arbeiten und Glätte möglichst erst gar nicht entstehen lassen. Die Einsätze werden so ausgelöst werden, dass vor dem Überfrieren bereits gestreut ist und das Salz zu wirken beginnen kann.
Wenn es vorhersehbar ist, streuen wir manchmal bereits in den späten Abendstunden, obwohl die Glätte erst für den nächsten Morgen vorhergesagt ist.
19. Wird in jedem Fall bei Minusgraden gestreut?
Ob eine trockene Fahrbahn gestreut werden sollte, muss gut überlegt sein. Das Salz selbst zieht Feuchtigkeit aus dem Umgebung an und unter Umständen wird die Straße genau dadurch glatt. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, ob nicht auf ein Abstreuen verzichtet werden sollte.
20. Wirkt das Salz auch bei ‑10 °C?
Die Wirksamkeit der Auftauwirkung des Salzes (Taumittel) hängt stark von der Temperatur ab. Das Taumittel Natriumchlorid NaCl (Kochsalz), was normalerweise verwendet wird, wirkt bis max. — 8 °C. Darunter müssen andere Salze z.B. MgCl, CaCl (Magnesiumchlorid oder Kalziumchlorid) verwendet werden.
Oft ist der Einsatz von Taumitteln dann aber gar nicht mehr notwendig, weil dann kaum noch mit Schneefall gerechnet werden muss und die Straßen auch „trockenfrieren“. Bei der sogenannten Sublimation geht das Eis direkt in Wasserdampf über. Diesen natürlichen Prozess kannten auch unsere Großeltern, die bei Minusgraden ihre Wäsche draußen auf der Leine getrocknet haben.
21. Warum wird nicht mit Sand oder Splitt gestreut?
Sand oder Splitt wirken zwar abstumpfend, können aber eine Glättebildung nicht ausreichend verhindern. Der Einsatz wäre allenfalls innerhalb der Ortschaften vertretbar. Außerorts stellen Sand oder Splitt nach dem Abtauen der Straße eine Gefährdung insbesondere für Zweiradfahrer dar und müssten regelmäßig abgekehrt werden.
Spätestens nach dem Winter müssen Straßen, Gräben, Regenwasserleitungen und Regenwasserabläufe gereinigt werden. Dabei entstehen durch Verunreinigungen große Mengen Abfall, die teuer entsorgt werden müssen. Zudem sind Sand und Splitt wertvolle Rohstoffe.
Streusalz in der richtigen Dosierung ist die umweltgerechteste Methode zur Glättebekämpfung und Aufrechterhaltung der Mobilität.
22. Wie soll ich mich als Kraftfahrer verhalten, wenn mir ein Winterdienstfahrzeug im Einsatz entgegenkommt oder vor mir fährt?
Winterdienstfahrzeuge im Einsatz sind durch ihre eingeschalteten gelben Rundumleuchten und rückwärtigen zusätzlichen Beleuchtungseinrichtungen weithin sichtbar.
Da auf Autobahnen mehrere Fahrbahnen gleichzeitig bedient werden müssen, sind häufig mehrere Räum- und Streufahrzeuge unterwegs, die über die gesamte Fahrbahnbreite verteilt sind und in Fahrtrichtung versetzt als sogenannter Verband fahren. Dadurch entstehen in Fahrtrichtung zwischen den einzelnen Fahrspuren Lücken, die die Kraftfahrer dazu verleiten, sie zum Überholen zu nutzen. Das sollte man grundsätzlich nicht tun, denn nach dem vielleicht geglückten Überholmanöver gelangt man mit Sicherheit auf noch nicht geräumte und gestreute Fahrbahnen, deren Glätte ein sehr hohes Risiko bedeutet, insbesondere auch bei den notwendigen Lenkbewegung ins Schleudern zu kommen. Auch bei der Hinterherfahrt sollte man sich immer bewusst sein, dass auch wenn unmittelbar zuvor gestreut wurde, das Streusalz seine Wirkung noch gar nicht entfalten konnte und die Glätte zunächst wie im nicht gestreuten Zustand vorhanden ist. Auch wenn bei einer Hinterherfahrt hinter einem Streufahrzeug das eigene Fahrzeug durch das ausgebrachte Streusalz in Mitleidenschaft gezogen wird, sollte die eigene Sicherheit oben anstehen.
Sind Räumfahrzeuge im Verband auf der Autobahn unterwegs, sollte man immer bedenken, dass der Schnee vom äußersten linken über die mittlere, die Hauptfahrspur bis auf den Standstreifen weitergegeben wird. Damit sollte immer davon abgesehen werden, diese Fahrzeuge zu überholen.
Kommt einem außerhalb der Autobahnen ein Streu- und Räumfahrzeug im Einsatz entgegen, sollte man seine Geschwindigkeit reduzieren und soweit wie möglich am rechten Fahrbahnrand fahren. Insbesondere Räumfahrzeuge nehmen mit ihrem Räumschild in der Regel die ganze Breite ihrer Fahrspur in Anspruch und können natürlich aufgrund der winterlichen Verhältnisse auch kurzfristig über ihre eigene Fahrspur hinaus kommen.
Außerhalb der Autobahnen sollte man immer bedenken, dass in einem Streudurchgang die gesamte Fahrbahnbreite, also auch die Fahrspur des Gegenverkehrs, gestreut wird, wobei meist lautstark das ausgebrachte Streusalz die entgegenkommenden Fahrzeuge trifft.
Beim Räumeinsatz ist ebenfalls zu bedenken, dass zwar jede Fahrspur für sich geräumt wird, es aber nicht ausgeschlossen ist, dass bei entsprechenden Windverhältnissen geräumter Schnee in Richtung der Gegenfahrbahn und damit der dort fahrenden Fahrzeuge gelangen kann.
Quelle: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Anzeige:
Sauna — Das Erholungsparadies
Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit und verbringen Sie einen Tag in Ostfrieslands größtem Saunaparadies. Sechs unterschiedlich temperierte Saunen sorgen in der Friesentherme Emden dabei für das perfekte Saunaerlebnis. Für die „Eventsauna“ bereiten unsere Aufgießer regelmäßig einen interessanten Aufgussplan vor – mal beruhigend, mal vitalisierend. Für die Erfrischung nach dem Saunagang stehen Ihnen unsere Abklingbecken und der beliebte Naturbadeteich zur Verfügung. Im großzügigen Saunagarten können Sie außerdem an vielen lauschigen Plätzchen verweilen, schaukeln und Frischluft tanken. Seit 2015 ist der Saunabereich mit dem Gütesiegel „SaunaPremium“ des Deutschen Saunabundes ausgezeichnet.

News
Pelzverbot in der EU: Kommission unter Druck nach Rekord-Bürgerinitiative

Bildunterschrift: Füchse in einer Pelzfarm — Copyright: Otwarte Klatki
Stillstand in Brüssel: Warum die EU beim Pelzverbot auf Zeit spielt
Das Thema Pelz spaltet Europa – zumindest wenn man die Kluft zwischen dem Bürgerwillen und dem Handeln der politischen Institutionen betrachtet. Seit drei Jahren fordern Millionen von Menschen ein Ende der Pelztierzucht und des Pelzhandels in der Europäischen Union. Doch trotz einer historischen Bürgerinitiative und erdrückender wissenschaftlicher Fakten herrscht in der EU-Kommission ein Schweigen, das für viele Tierschützer mittlerweile unerträglich wird.
1,5 Millionen Stimmen gegen Tierquälerei
Bereits im Jahr 2023 setzte die Europäische Bürgerinitiative (EBI) „Fur Free Europe“ einen Meilenstein: Mit über 1,5 Millionen zertifizierten Unterschriften wurde eine der erfolgreichsten Bürgerinitiativen der EU-Geschichte eingereicht. Die Forderung ist klar: Ein EU-weites Verbot der Haltung und Tötung von Tieren zum Zweck der Pelzgewinnung sowie ein Verbot des Inverkehrbringens von Zuchtpelzen auf dem europäischen Markt.
Trotz dieses massiven Mandats steht eine finale Antwort der Kommission bis heute aus. Bei einer jüngsten Protestaktion des internationalen Bündnisses „Fur Free Alliance“ in Brüssel machten Organisationen wie der Deutsche Tierschutzbund erneut deutlich, dass das Ignorieren dieses demokratischen Werkzeugs das Vertrauen in die EU-Politik massiv beschädigt.
Wissenschaft und Gesundheit: Mehr als „nur“ Tierschutz
Die Argumente gegen die Pelzindustrie beschränken sich längst nicht mehr nur auf ethische Bedenken. Dr. Henriette Mackensen, Fachreferentin für Pelz beim Deutschen Tierschutzbund, betont die Komplexität der Risiken:
-
Tierschutz: Pelztiere wie Nerze und Füchse sind Wildtiere, deren Grundbedürfnisse in engen Gitterkäfigen niemals erfüllt werden können.
-
Öffentliche Gesundheit: Pelzfarmen gelten als Brutstätten für Zoonosen. Der Ausbruch von COVID-19-Mutationen auf Nerzfarmen hat gezeigt, wie gefährlich diese Haltungsformen für den Menschen sein können.
-
Umwelt: Die Verarbeitung von Pelzen erfordert den Einsatz hochgiftiger Chemikalien, um die Verwesung der Häute zu stoppen – eine enorme Belastung für Boden und Grundwasser.
Neue Umfragedaten: Ein klares Mandat der Bevölkerung
Eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsunternehmens Savanta unter 18.000 EU-Bürgern untermauert den Wunsch nach Veränderung. Die Ergebnisse für Deutschland sind dabei besonders deutlich:
| Forderung | Zustimmung (Deutschland) |
| EU-weites Verbot der Pelztierzucht | 78 % |
| Einfuhrverbot für Pelze aus Nicht-EU-Staaten | 80 % |
| Ablehnung eines Verbots | 8 % |
Diese Zahlen belegen, dass die Bürgerinitiative kein Nischenthema ist, sondern von einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit getragen wird.
Intransparenz und politische Blockaden
Kritik gibt es vor allem an der Art der Kommunikation hinter den Kulissen. Jürgen Plinz, Präsidiumsmitglied beim Deutschen Tierschutzbund, äußert den Verdacht, dass die Kommission eher das Gespräch mit der Pelzlobby sucht als mit den Vertretern der Zivilgesellschaft. Während Standards offenbar bereits mit der Industrie verhandelt wurden, blieben Gesprächsangebote von Tierschutzverbänden oft unbeantwortet.
Dieses Vorgehen nährt den Vorwurf, dass wirtschaftliche Interessen einzelner Mitgliedstaaten über das Tierwohl und den erklärten Willen der EU-Bürger gestellt werden.
Entscheidung im März: Die Stunde der Wahrheit
Nach langem Zögern wird eine offizielle Antwort der EU-Kommission nun für Ende März 2026 erwartet. Für die Tierschutzorganisationen und die 1,5 Millionen Unterzeichner ist dies der Moment der Wahrheit. Es geht nicht nur um das Schicksal von Millionen Pelztieren, sondern auch darum, wie ernst die EU ihre eigenen demokratischen Instrumente wie die Bürgerinitiative nimmt.
Ein Aufschub oder eine bloße „Optimierung“ der Haltungsbedingungen wäre aus Sicht der Initiatoren eine herbe Enttäuschung und ein fatales Signal an die Bürger.
Anzeige
Anzeige
Emder Matjes Delikatessen: Frühlingsrolle auf Apfel-Chilikompot

Emder Matjes Delikatessen: Fernöstliche Akzente in Folge 4
In der vierten Ausgabe der Serie „Emder Matjes Delikatessen“ trifft norddeutsche Tradition auf asiatische Raffinesse. Das Rezept für Frühlingsrollen vom Emder Matjes auf Apfel-Chilikompot zeigt, wie wandelbar der klassische Matjes ist und wie harmonisch er mit exotischen Aromen harmoniert.
Wenn zarte Emder Matjesfilets auf Mango, Ingwer und Sojasauce treffen, entsteht eine Vorspeise, die den Gaumen überrascht. Die Kombination aus der Salzigkeit des Matjes, der fruchtigen Süße der Mango und der leichten Schärfe des Ingwers verleiht dem Gericht eine moderne, süßsaure Note. Eingehüllt in knusprigen Frühlingsrollenteig, wird der Fisch zu einem völlig neuen Erlebnis.
Das Rezept: Knuspriger Matjes trifft fruchtiges Kompott
Für vier Personen bildet das Zusammenspiel aus Textur und Temperatur das Herzstück dieses Gerichts. Während die Frühlingsrollen heiß serviert werden, sorgt das selbstgemachte Apfel-Chilikompot für eine fruchtig-pikante Basis.
Zutaten für die Frühlingsrollen
-
4 Emder Matjesfilets
-
½ Mango, ½ rote Paprika, 1 rote Zwiebel
-
50 g Sojasprossen, 4 Stangen grüner Spargel
-
10 g Ingwer, 2 cl Sojasauce
-
Koriander, Salz, Pfeffer, Zucker
-
4 Blatt Frühlingsrollenteig & 1 Eiweiß
Zutaten für das Apfel-Kompott
-
3 Äpfel, ½ Zwiebel, ½ rote Chilischote
-
100 g Zucker, 2 EL Essig, 50 g Butter
-
Apfelsaft, Salz, Pfeffer
Schritt für Schritt zur maritimen Vorspeise
-
Die Füllung: Matjesfilets, Mango, Spargel, Paprika und Zwiebeln in feine Würfel schneiden. Mit gehacktem Koriander vermengen und mit Sojasauce sowie frisch geriebenem Ingwer abschmecken.
-
Das Rollen: Den Teig auslegen, Ränder mit Eiweiß bestreichen, Füllung platzieren und die Seiten eingeschlagen fest aufrollen.
-
Das Kompott: Zucker karamellisieren, gewürfelte Äpfel, Zwiebeln und Chili hinzugeben und mit Apfelsaft ablöschen. Etwa 5 bis 7 Minuten köcheln lassen und mit Butter verfeinern.
-
Das Finale: Die Rollen bei 180°C etwa 3 Minuten goldbraun ausbacken. Das Kompott mittig auf einem tiefen Teller anrichten und die Frühlingsrolle darauf platzieren.
Kulinarischer Tipp: Für das perfekte Finish und eine zusätzliche Textur eignen sich Wasabi-Erbsen und Krabbenchips hervorragend als Garnitur.

Anzeige
Werte schaffen. Energiekosten senken. Fürs Alter vorsorgen. Jetzt loslegen.

Clever ins Eigenheim investieren – Werte schaffen, Energiekosten senken, fürs Alter vorsorgen. Jetzt loslegen.
Wer heute in sein Zuhause investiert, denkt weiter als nur bis zur nächsten Renovierung. Es geht um Werterhalt, um nachhaltige Kostensenkung und um eine solide Altersvorsorge. Genau hier setzt Finanzierungsexperte Sven Albert aus Leer an. Als BauWoLe-Partner verbindet er Eigenheimbesitzer mit dem passenden Handwerk – und sorgt dafür, dass Ihr Projekt auf einem stabilen finanziellen Fundament steht.
Ob neue Küche, Wintergarten, Auffahrt, Wärmedämmung oder moderne Heizungsanlage: Jede Maßnahme steigert Komfort und Immobilienwert. Besonders energetische Sanierungen zahlen sich langfristig aus – durch deutlich geringere Energiekosten und eine höhere Unabhängigkeit von Preissteigerungen.
Ganzheitlich planen statt Stückwerk finanzieren
Sven Albert empfiehlt, Modernisierungen nicht isoliert zu betrachten. Wer beispielsweise eine neue Küche plant, sollte auch angrenzende Gewerke realistisch mit einkalkulieren:
-
Erneuerung der Elektrik
-
modernes Beleuchtungskonzept
-
neue Wand- und Bodenfliesen
-
notwendige Malerarbeiten
Oft entstehen genau hier zusätzliche Kosten, die im ersten Moment unterschätzt werden. Eine durchdachte Finanzierung berücksichtigt deshalb nicht nur die Hauptinvestition, sondern das gesamte Projektumfeld.
Sein Rat: Lieber einen finanziellen Puffer einplanen. Unerwartete Mehrkosten lassen sich so souverän abfangen, ohne dass Ihre Kalkulation ins Wanken gerät.
Mehrere Projekte bündeln – effizienter und oft günstiger
Nicht selten lohnt es sich, zwei oder sogar drei Maßnahmen in einem Zug zu finanzieren. Wer beispielsweise die Küche modernisiert, kann gleichzeitig die Elektrik auf den neuesten Stand bringen oder angrenzende Räume renovieren.
Das Ergebnis:
-
nur eine Bauphase
-
bessere Abstimmung der Gewerke
-
häufig günstigere Gesamtkonditionen
-
schnellerer Abschluss der Arbeiten
Denn Hand aufs Herz: Wer möchte schon dauerhaft auf einer Baustelle wohnen?
Werte sichern – Zukunft gestalten
Jede Investition ins Eigenheim ist auch eine Investition in Ihre Zukunft. Modernisierungen erhöhen die Lebensqualität, steigern den Immobilienwert und sorgen dafür, dass größere Sanierungen im Rentenalter bereits abgeschlossen sind.
Wer heute in Dämmung, effiziente Heiztechnik oder hochwertige Ausstattung investiert, reduziert langfristig Betriebskosten und schafft finanzielle Entlastung für später.
Ihr starker Partner in Leer
Sven Albert begleitet Sie mit Erfahrung, Marktkenntnis und einem klaren Blick für wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. Als BauWoLe-Partner bringt er Handwerk und Finanzierung zusammen – strukturiert, planbar und transparent.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Ihr Projekt strategisch anzugehen.
Mit einer cleveren Finanzierung schaffen Sie Werte, senken Energiekosten und sorgen nachhaltig fürs Alter vor.
Seriöse Finanzierung – direkt vor Ort mit persönlicher Beratung
Bei Sven Albert haben Sie einen kompetenten Partner an Ihrer Seite – gemeinsam mit der traditionellen Bausparkasse Schwäbisch Hall. Hier bauen Sie eine seriöse, solide Finanzierung auf, die genau auf Ihre Wohnträume und Pläne zugeschnitten ist. Schon bevor Sie mit der Renovierung, dem Anbau oder der Modernisierung Ihres Eigenheims beginnen, können Sie die Finanzierung in trockenen Tüchern haben.
Sie wissen von Anfang an, welchen Finanzierungsrahmen Sie haben, können Puffer für unerwartete Mehrkosten einplanen und alle verfügbaren Fördermöglichkeiten optimal nutzen. Anders als bei anonymen Callcentern haben Sie hier einen direkten Ansprechpartner aus Ostfriesland, der Sie persönlich begleitet, auf Ihre Fragen eingeht und Sie Schritt für Schritt unterstützt.
Sven Albert verfügt über langjährige Erfahrung mit Neubau- und Modernisierungsprojekten und ein großes Netzwerk an Bau- und Handwerkspartnern. So können Sie sicher sein, dass Ihr Projekt professionell geplant, finanziert und umgesetzt wird – ohne böse Überraschungen. Ein Beratungsgespräch ist unverbindlich und kostenfrei und sollte frühzeitig als erster Schritt genutzt werden, damit alle weiteren Maßnahmen auf einer sicheren Basis starten können. So wird Ihr Eigenheimtraum von Anfang an Realität – entspannt, planbar und abgesichert.
Kontaktieren Sie Sven Albert – Ihr persönlicher Berater vor Ort
Sven Albert
Selbstständiger Berater
Mobil: 01522 / 2686457
Telefon: 0491 / 20340108
E‑Mail: sven.albert@schwaebisch-hall.de
Neues Büro in 26789 Leer:
Heisfelder Str. 111 a
Tel: 0491 / 20340108